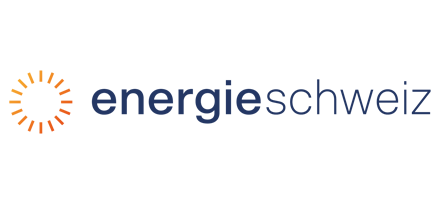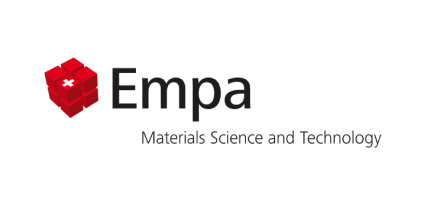Erneuerbare Energie kann auch in Form von komprimierter Luft gespeichert und bei Bedarf über eine Turbine wieder nutzbar gemacht werden. Solche Druckluftspeicher lassen sich danach unterscheiden, wie sie mit der Wärme umgehen, die einerseits beim Komprimieren der Luft entsteht und andererseits für die Expansion (Dekomprimieren) wieder zugeführt werden muss, damit die Turbine nicht vereist. Speichertyp 1 führt die Wärme beim Komprimieren über einen Wärmetauscher an die Umgebung ab. Die benötigte Wärme für die Expansion der Luft bezieht dieser Typ durch die Verbrennung eines fossilen Brennstoffs. Daher wird er mit einem Gaskraftwerk kombiniert. «Da wir für die Energiewende erneuerbare Technologien brauchen, kommt dieser Typ für die Schweiz nicht infrage», relativiert Andreas Haselbacher vom Energy Science Center der ETH.
Treibhausgase vermeiden
Zwei andere Druckluftspeicher-Typen funktionieren ohne CO2-Emissionen, sondern nutzen erneuerbare Energie für die Prozesse. Typ 2 speichert die bei der Kompression entstehende Wärme in einem thermischen Speicher. Bei der Expansion wird sie der Luft wieder zugeführt – das vermeidet nicht nur den Ausstoss von Treibhausgasen, sondern ist mit einem Wirkungsgrad von bis zu 75 % auch sehr effizient. Eine weitere Alternative ist Typ 3: Die Luft wird während der Kompression gekühlt und während der Expansion erwärmt, sodass keine Wärme gespeichert werden muss. «Der Nachteil dieses Typs ist der komplizierte Aufbau, der für die konstante Kühlung respektive Erwärmung der Luft nötig ist», erklärt ETH-Forscher Haselbacher.
Pilotprojekt im Tessin
Typ 2 ist aufgrund des einfacheren Aufbaus attraktiver als Typ 3. Eine Forschungsgruppe mit Vertretern von Hochschulen und Industrie hat mit der weltweit ersten Pilotanlage bereits mehrere Projekte dazu durchgeführt. Die Anlage befindet sich in einem ehemaligen NEAT-Stollen bei Biasca. «Die Resultate zeigen, dass Druckluftspeicher mit thermischem Speicher technisch machbar, wirtschaftlich betreibbar und ähnlich umweltfreundlich wie Pumpspeicher sind», so Andreas Haselbacher. Der Vorteil sei, dass man Druckluftspeicher komplett unterirdisch bauen könne, etwa in ausgemusterten Kavernen der Schweizer Armee. Damit sind die Hürden für einen Ausbau der Technologie deutlich tiefer als bei den Pumpspeichern, für die man oberirdisch einen geeigneten Platz finden muss. Allerdings ist die Speicherkapazität begrenzt, sodass sich Druckluftspeicher eher für die kurzfristige als für die langfristige Speicherung von erneuerbarer Energie eignen.
Der Vorteil ist, dass man Druckluftspeicher unterirdisch bauen kann, etwa in ausgemusterten Kavernen der Schweizer Armee.